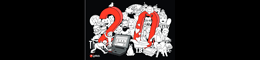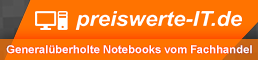Zum aktuellen Anlass... Quelle N-TV:
Der Klimawandel ist eine Lüge. Es hat schon immer kältere und wärmere Phasen auf der Erde gegeben. Nicht der Mensch ist für den derzeitigen Anstieg der Temperaturen verantwortlich, sondern dieser ist ein ganz natürliches Phänomen. Kohlendioxid (CO2) ist ein lebenswichtiges Treibhausgas, das keinen Einfluss auf die Erderwärmung hat und zudem Pflanzen beim Wachstum hilft. Wir steuern nicht auf eine Klimakatastrophe zu, sondern unterliegen einer reglerechten "Klimahysterie", die Skeptikern des Klimawandels den Mund verbietet und eine Kampagne politischer Wissenschaftler ist.
So lautet, vereinfacht zusammengefasst, die Kritik an der "Klimalüge" - der von Menschen angeheizte Klimawandel wird in Frage gestellt oder sogar ganz bestritten. Die Überzeugung dieser "Klima-Leugner": Wir sitzen einem riesigen Schwindel auf und verschwenden Zeit und Geld in die Bekämpfung von etwas, das es gar nicht gibt.
"Climate-Gate"
Unmittelbar vor Beginn des Klimagipfels in Kopenhagen haben die Skeptiker noch einmal Auftrieb bekommen, nachdem E-Mails führender Klimaforscher aus mehr als zehn Jahren gehackt und veröffentlicht wurden. Darin sollen sich die Wissenschaftler unter anderem über die "Idioten" der Klimaskeptiker auslassen und beratschlagen, wie sie kritische Studien unterdrücken können. Die "Klima-Leugner" sprechen bereits von "Climate-Gate", in Anlehnung an den Watergate-Skandal, der US-Präsident Richard Nixon zu Fall brachte. Sie wittern den größten Betrug in der Geschichte der Wissenschaft. Die betroffenen Klimaforscher vermuten dagegen eine gezielte Sabotage, um den Klimagipfel in Kopenhagen zu diskreditieren.
Können sich die über 2000 Wissenschaftler des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) irren, die als sogenannter Weltklimarat" seit 1990 den offiziellen Klimabericht verfassen und der die Grundlage für die Verhandlungen in Kopenhagen ist? Was ist dran an den Einwänden der "Klima-Leugner"?
Treibhauseffekt ist lebenswichtig
Vorweg genommen sei: Kohlendioxid ist nicht per se etwas Böses, das bestreitet kein ernstzunehmender Wissenschaftler. Ohne den natürlichen Treibhauseffekt würden wir auf der Erde nicht leben können. Denn erst durch die Gase in der Atmosphäre, allen voran Wasserdampf und Kohlendioxid, wird die an sich minus 18 Grad kalte Erde auf im Schnitt lebensfreundliche 15 Grad erwärmt. Nach Angaben des Potsdamer Instituts für Klimaforschung (PIK) verursacht Wasserdampf rund 66 Prozent dieses Effekts, CO2 etwa 29 Prozent. Wie das funktioniert? Vereinfacht gesagt: Die natürlichen Treibhausgase lassen die Sonnenstrahlen zwar zur Oberfläche durchdringen, nehmen die von der Erde reflektierten Strahlen dann aber auf und speichern sie. Die Atmosphäre erwärmt sich.
Kohlendioxid ist also nicht von Haus aus schlecht. Doch darum geht es nicht. Zwei Fragen gilt es zu beantworten: Hat CO2 einen Einfluss auf die Erderwärmung und in wie weit ist der Anstieg der Temperatur auf der Erde durch Menschen verursacht?
These 1: Temperaturwechsel gab es immer
Zu den prominenteren Skeptikern des Klimawandels zählt etwa der emeritierte US-amerikanische Physiker Fred Singer, der unter anderem in dem Film "Der Klimaschwindel" seine Bedenken erklärt und bis 2003 bezweifelte, dass es überhaupt eine messbare Erwärmung der Erde gebe. Diese Position hat er zwar wegen der eindeutigen Fakten revidiert: Seit 1900 ist die Temperatur um 0,8 Grad angestiegen. Bei einem Besuch in Deutschland Ende November unterstrich Singer aber seine Bedenken: "Selbst wenn es tatsächlich eine von uns Menschen verursachte Erwärmung gibt – woran ich zweifle – ist das überhaupt nicht schlimm. Ein wärmeres Klima ist besser für die Menschheit als ein kälteres", sagte er der "Rhein-Zeitung". Die einhellige Meinung der Klimaskeptiker: Temperaturschwankungen hat es auf der Erde schon immer gegeben, sie sind kein Anlass zur Sorge.
These 2: CO2-Anstieg spielt keine Rolle
Wie die meisten Klimaskeptiker bestreitet Singer auch nicht, dass es einen Anstieg des Kohlendioxids in der Atmosphäre gegeben hat und dass die Menschen dafür mitverantwortlich sind. Was Singer aber verneint: Dass es zwischen beiden Phänomenen einen Zusammenhang gibt: "Die vom Menschen verursachten Treibhausgase spielen allenfalls eine minimale Rolle für das Klima", erklärte er in dem Zeitungsinterview Ende November. Die vergangenen zehn Jahre würden es beweisen: Der CO2-Anteil sei deutlich angestiegen, aber es sei überhaupt nicht wärmer geworden. "Ich rechne sogar damit, dass es eher kühler wird", sagte Singer. Dass die Fakten dem eindeutig widersprechen, wie erst jetzt durch die Weltwetterorganisation WMO bewiesen, scheint Singer nicht zu beeindrucken.
"Die 1990er Jahre waren das wärmste Jahrzehnt seit Beginn der Aufzeichnungen, und die zehn wärmsten Jahre fanden alle seit 1990 statt", belegt auch Klimaforscher Rahmstorf. Die global wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen seien 1998, 2002 und 2003 gewesen. Rahmstorf setzt sich seit Jahren mit den Argumenten der "Klima-Leugner" auseinander. Der Wissenschaftler bestreitet nicht, dass es in der Geschichte der Erde unabhängig vom CO2-Gehalt Klimaveränderungen und teils abrupte Temperaturwechsel gab. "Es geht also nicht darum, dass CO2 der einzige oder stets dominante Klimafaktor war", stellt er fest. Für ihn ist aber ebenso wie für die Wissenschaftler des Weltklimarats IPCC bewiesen, dass zum einen sich der CO2-Gehalt durch den Menschen um 30 Prozent erhöht hat und zum anderen damit eine Erwärmung der Erde einhergeht: "Verdoppelt sich der CO2-Gehalt der Luft, steigt die globale Mitteltemperatur um 2 bis 4 Grad an", schreibt der Wissenschaftler.
These 3: Wasserdampf ist größtes Treibhausgas
Nach Ansicht der "Klima-Leugner" ist Wasserdampf in der Atmosphäre ein viel wichtigeres Treibhausgas als CO2 – und das werde in den gängigen Klima-Modellen nicht berücksichtigt. Den Einfluss von Wasserdampf bestreiten die an den Ergebnissen der Klimastudien beteiligten Forscher aber nicht. Schließlich ist Wasserdampf hauptverantwortlich für den natürlichen Treibhauseffekt. Deshalb wird Wasserdampf nach Angaben des Potsdamer Klimainstituts auch in allen Modellen als Faktor einbezogen. Das Problem aber ist: Der Anteil des Wasserdampfes in der Atmosphäre lasse sich kaum beeinflussen. Der Anteil von CO2 aber sehr wohl, zumindest was den vom Menschen verursachten Ausstoß anbelange.
These 4: Die Sonne macht das Klima
Doch die Klimaskeptiker halten den Faktor des von Menschen verursachten CO2-Anteils für vernachlässigbar. Viel entscheidender seien natürliche Einflüsse wie die Aktivität der Sonne. Das etwa meint auch Horst Malberg, ehemaliger Professor für Meteorologie an der Freien Universität Berlin, der den "dominierenden solaren Einfluss auf den Klimawandel" ausgemacht hat und einen Zusammenhang zwischen Sonnenflecken und Temperatur auf der Erde herstellt: Je weniger Sonnenflecken, desto kälter wird es. "Der veränderliche solare Energiefluss ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der dominierende Antrieb im Klimasystem der Erde", schreibt er auf der Internetseite "Klimaskeptiker". Nur ein Drittel der Erderwärmung sei auf menschliche Einflüsse zurückzuführen.
Der Einfluss der Sonnenstrahlung auf das Klima der Erde ist in der Tat ein Faktor, der in der Wissenschaft derzeit noch diskutiert wird und in seiner Wirkung noch nicht eingeschätzt werden kann. Der Potsdamer Klimaforscher Rahmstorf weist darauf hin, dass dabei zwischen direkten und indirekten Wirkungen durch die Sonnenstrahlung unterschieden werden muss – und die direkte Sonnenstrahlung habe "über Jahrzehnte nur um etwa 0,1 Prozent" geschwankt und sei damit vernachlässigbar. Was den indirekten Einfluss angehe, tappe die Wissenschaft im Dunkeln.
Allerdings widerspricht Rahmstorf der These des Einflusses der Sonnenflecken und Malberg vehement. Die Datengrundlage solcher Studien habe sich als falsch erwiesen, die entsprechenden Studien hätten mit einem statistischen Trick gearbeitet.
"Es genügt nicht einfach, wie die Skeptiker das tun, irgendwelche Daten aus dem Hut zu zaubern, man muss schon etwas genauer hinschauen und die physikalischen Mechanismen berücksichtigen", sagt der Schweizer Klimaforscher Thomas Stocker von der Universität Bern gegenüber n-tv.de. Stocker ist Mitglied im IPCC und einer der Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Wissenschaft. Wer sich von den Kritikern die Mühe mache und den 1000-seitigen Bericht des Weltklimarats lese, finde darin sehr wohl auch Diskussionen um umstrittene Thesen berücksichtigt.
Skeptiker sind eingebunden
Deshalb kann er die Vorwürfe der "Klima-Leugner" nicht nachvollziehen, kritische Meinungen würden mundtot gemacht. Bereits im dritten IPCC-Bericht von 2001 seien auch zwei explizite Klimawandelskeptiker als Mitautoren vertreten: John Christy von der University of Alabama und Richard Linzen vom Massachusetts Institute of Technology. "Und sie haben den Bericht damals unterschrieben", betont Stocker.
Die Klimaforscher Stocker und Rahmstorf bemängeln, dass die Skeptiker des Klimawandels immer wieder mit Einzelfällen und statistischen Tricks ihre Thesen zu belegen versuchten. Das wird ihnen umgekehrt allerdings auch gerne vorgeworfen.
Alles nur Szenarien
IPCC-Mitglied Stocker verweist deshalb auf die breite wissenschaftliche Basis, die den Studien des Weltklimarats zugrunde liegt: "Grundlage sind sämtliche gemessene Daten meteorologischer Stationen auf dieser Welt." Die Daten würden auch auf ihre Qualität geprüft sowie auf ihre Konsistenz und ihre Langzeitzuverlässigkeit. Zugleich stellt der Klimaforscher aber klar, dass dies nur Szenarien zur Klimaveränderung seien. "Es handelt sich nicht um Prognosen im eigentlichen Sinn, also unabdingbare Zukünfte, sondern um sogenannte Projektionen." Dieses Wort impliziere, dass es verschiedene Szenarien gebe. "Das heißt, es spielt eine zentrale Rolle, wie viele fossile Brennstoffe in Zukunft ausgestoßen und wie groß die Abholzungen der tropischen Regenwälder ausfallen werden", sagt Stocker. Ziel sei es, Öffentlichkeit und politische Entscheidungsträger "auf robuste und transparente Art und Weise über den Wissenstand in der Klimaforschung bezüglich des Klimawandels" zu informieren.
Wirschaftlich gesteuerte Interessen
Zusätzlich angeheizt wird der Streit zwischen Klimaskeptikern und Wissenschaftlern, die vom Klimawandel überzeugt sind, durch gegenseitige Vorwürfe wirtschaftlicher Interessen. So vermutet etwa der Potsdamer Forscher Rahmstorf hinter einigen Positionen prominenter "Klima-Leugner" wirtschaftliche Lobby-Gruppen. So landeten auch vermeintlich wissenschaftliche Studien der Braunkohleindustrie auf seinem Schreibtisch. Auch Skeptiker Singer ist höchst umstritten. Die britische Zeitung "The Guardian" weist ihn als ehemaligen Tabaklobbyisten aus und das Magazin "Newsweek" beschreibt ein Treffen Singers mit Vertretern von US-amerikanischen Mineralölkonzernen, um eine PR-Kampagne gegen die Überzeugung des von Menschen verursachten Klimawandels zu organisieren.
Umgekehrt werfen die Skeptiker den Forschern, die vor dem Klimawandel warnen, vor, sich durch die Forschungen wichtige Drittmittel und Aufträge für Studien sichern zu wollen. "Die Regierungen geben sehr viel Geld für Forschung aus und davon sind viele Wissenschaftler abhängig. Vor allem junge Forscher sind angewiesen auf diese Mittel, bis sie sich etabliert haben", sagte etwa Singer. Und auch dem Potsdamer Forscher Rahmstorf werfen die Skeptiker vor, im finanziellen Interesse der Münchner Rück zu handeln: Damit der Konzern höhere Versicherungsprämien verlangen könnte, würden bewusst Horrorszenarien des Klimawandels geschaffen.
Rahmstorf kennt die Vorwürfe und outet sich deshalb als Überzeugungstäter: "Meine privaten Konsequenzen aus dem Klimawandel (etwa kein Auto zu besitzen, am Haus optimale Wärmedämmung und Solaranlage zu installieren) habe ich wohl kaum deshalb gezogen, um mehr Forschungsmittel zu bekommen." Dabei wehre er sich genauso sehr gegen die Vereinnahmung von Klimawandel-Hysterikern. Schwarze Schafe – auch in den eigenen Reihen – kann er deshalb natürlich nicht ausschließen. Im Zweifel empfiehlt er deshalb, sich selbst zu informieren - über die Fakten und die Personen, die sie vertreten. Dafür gebe es unabhängige Seiten wie Lobbycontrol oder Sourcewatch, die versteckte Interessen von Wissenschaftlern wie Singer offenlegen könnten.