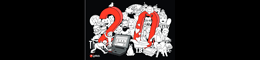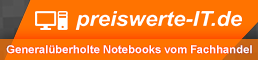Nun, meine Skepsis gegenüber den Kupferplättchen habe ich ja bereits zum Audruck gebracht. Die Gründe mag ich jetzt gar nicht alle schreiben, es sind viele und das wäre einfach eine Menge Text und Mühe, ohne dass es was bringt.
===
Ich sehe mir gerne Konstruktionen an so wie sie sind, und versuche nachzuvollziehen, warum. Das gelingt mir bei den kombinierten CPU/GPU/Chipset/VRAM-Kühlern recht schnell:
Das erste Kupferpad sitzt auf dem Chip, der die größere Verlustleistung hat, direkt auf. Die Höhe des Chips ist dann die Referenz - der Nullpunkt, von dem aus alle Toleranzwerte in der Höhe gerechnet werden. Der Wärmeübergang wird hier mit Leitpaste hergestellt, die so dünn wie möglich aufgetragen werden soll. Der nötige Anpressdruck wird mit einer Kombination aus Schraubverbindung und Federkraft erzielt. Damit ist gewährleistet, dass auch bei einem späteren Schwund der Leitpaste eine Pressung erhalten bleibt.
Das zweite Kupferpad mit der hier längeren Heatpipe geht zu einem Chip, bei dem die Anforderung an die Kühlung geringer ist. Hier ist auch ein größerer Abstand zwischen dem ableitenden Kupferpad und dem Chip, so zwischen 0.5 und 2.0mm. Dieser Abstand ist offenbar nötig, um Toleranzen ausgleichen zu können und nicht zu groß, als dass der Chip nicht ausreichend gekühlt würde. Die Kühlereinheit kann bei dieser Größe und Gewicht kein mechanisches Präzisionsbauteil sein, und weitere Abweichungen ergeben sich noch durch Toleranzen in der Höhe der CPU (mit Sockel) und der Bestückung des Mainboards. Wenn diese Kühlfläche jetzt noch (einseitig) im Structure Frame eingeklemmt und dadurch nach unten gedrückt wird, steht sie aufgrund der Elastizität der Heatpipes zudem potenziell schief zur ersten Kühlfläche. Das kann aber ein Wärmeleitpad wunderbar ausgleichen.
Ein zusätzlich hineinkonstruiertes Kupferblech würde jetzt das vorhandene Design ändern - und da sollte man 1. wissen, was man macht, 2. warum und 3. wäre es eventuell nicht sehr gut eingesetzte Lebenszeit.
... ich arbeite ja viel lieber mit den ThinkPads, als an ihnen.
Und deshalb kommt bei mir nach einiger Überlegung Leitpaste dahin, wo vorher Leitpaste war - und Pads, da wo Pads hingehören - laptopheaven verzeiht mir sicher die Wiederholung seiner Worte.
PS/1; @ patronus:
Ob man jetzt für Kupferblech, so wie es erhältlich ist, tatsächlich λ: 400 W/mK ansetzen kann, wobei sich das auf das reine Element bei 0°C bezieht, bezweifle ich. Außerdem gilt das von Dir angeführte λ: 10 W/(mK), so es denn überhaupt zutreffend ist, tatsächlich von angrenzender Fläche zu angrenzender Fläche. Bei Kupfer ist das aber in der Praxis nicht der Fall, so dass Pferdles freundlicher Hinweis in Posting #16 schon angebracht war.
PS/2:
Irgendwie scheint ja das Thema Chipkühlung besonders zur Gemütererhitzung geeignet zu sein (*). Jedenfalls erinnert es mich an einen Thread, in dem ich frech behauptet hatte, Wärmeleitpads könne man nach der Demontage für eine weitere Verwendung wieder zurechtdrücken. ojojojojoj. Schlimmer Fehler.
* Peltier-Effekt?
===
Ich sehe mir gerne Konstruktionen an so wie sie sind, und versuche nachzuvollziehen, warum. Das gelingt mir bei den kombinierten CPU/GPU/Chipset/VRAM-Kühlern recht schnell:
Das erste Kupferpad sitzt auf dem Chip, der die größere Verlustleistung hat, direkt auf. Die Höhe des Chips ist dann die Referenz - der Nullpunkt, von dem aus alle Toleranzwerte in der Höhe gerechnet werden. Der Wärmeübergang wird hier mit Leitpaste hergestellt, die so dünn wie möglich aufgetragen werden soll. Der nötige Anpressdruck wird mit einer Kombination aus Schraubverbindung und Federkraft erzielt. Damit ist gewährleistet, dass auch bei einem späteren Schwund der Leitpaste eine Pressung erhalten bleibt.
Das zweite Kupferpad mit der hier längeren Heatpipe geht zu einem Chip, bei dem die Anforderung an die Kühlung geringer ist. Hier ist auch ein größerer Abstand zwischen dem ableitenden Kupferpad und dem Chip, so zwischen 0.5 und 2.0mm. Dieser Abstand ist offenbar nötig, um Toleranzen ausgleichen zu können und nicht zu groß, als dass der Chip nicht ausreichend gekühlt würde. Die Kühlereinheit kann bei dieser Größe und Gewicht kein mechanisches Präzisionsbauteil sein, und weitere Abweichungen ergeben sich noch durch Toleranzen in der Höhe der CPU (mit Sockel) und der Bestückung des Mainboards. Wenn diese Kühlfläche jetzt noch (einseitig) im Structure Frame eingeklemmt und dadurch nach unten gedrückt wird, steht sie aufgrund der Elastizität der Heatpipes zudem potenziell schief zur ersten Kühlfläche. Das kann aber ein Wärmeleitpad wunderbar ausgleichen.
Ein zusätzlich hineinkonstruiertes Kupferblech würde jetzt das vorhandene Design ändern - und da sollte man 1. wissen, was man macht, 2. warum und 3. wäre es eventuell nicht sehr gut eingesetzte Lebenszeit.
... ich arbeite ja viel lieber mit den ThinkPads, als an ihnen.
Und deshalb kommt bei mir nach einiger Überlegung Leitpaste dahin, wo vorher Leitpaste war - und Pads, da wo Pads hingehören - laptopheaven verzeiht mir sicher die Wiederholung seiner Worte.
PS/1; @ patronus:
Ob man jetzt für Kupferblech, so wie es erhältlich ist, tatsächlich λ: 400 W/mK ansetzen kann, wobei sich das auf das reine Element bei 0°C bezieht, bezweifle ich. Außerdem gilt das von Dir angeführte λ: 10 W/(mK), so es denn überhaupt zutreffend ist, tatsächlich von angrenzender Fläche zu angrenzender Fläche. Bei Kupfer ist das aber in der Praxis nicht der Fall, so dass Pferdles freundlicher Hinweis in Posting #16 schon angebracht war.
PS/2:
Irgendwie scheint ja das Thema Chipkühlung besonders zur Gemütererhitzung geeignet zu sein (*). Jedenfalls erinnert es mich an einen Thread, in dem ich frech behauptet hatte, Wärmeleitpads könne man nach der Demontage für eine weitere Verwendung wieder zurechtdrücken. ojojojojoj. Schlimmer Fehler.
* Peltier-Effekt?
Zuletzt bearbeitet: